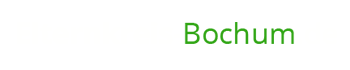Bericht von Ingo
Als mein Bruder zu erzählen begann, dass er überall verfolgt werde und davon, dass er zudem jederzeit beobachtet werde, ahnte ich bereits, dass er aufgrund seines hohen Drogenkonsum in ein psychotische Phase abglitt. Seine Nachbarn, war er überzeugt, sowie die VerkäuferInnen und KassiereInnen im Supermarkt, ja auch alle Passanten, würden tuscheln und schlecht über ihn reden. Er hatte gar Angst, denn sogar bis vor seine Haustür werde er verfolgt; nur wenn er schnell genug die Tür aufschloss, konnte er entkommen.
In seiner Wohnung kam er jedoch auch nicht zur Ruhe. Er fantasierte, dass sein Vermieter ihn los werden wolle und daher besonders laut polterte und / oder Musik aufdrehte. Dessen Kinder würden über ihn lachen und ihn bewusst und voller Absicht ärgern. Einmal erzählte er, dass sie im Garten etliche Fliegen eingefangen hätten, die sie unter großen Gelächter in sein Schlafzimmer entlassen hätten.
Zu dieser Zeit konsumierte er neben Methadon, durch das er seit langem substituiert wird, große Mengen an Benzodiazepinen und weiteren Tabletten. Als er dann verstärkt suizidale Gedanken äußerte, bat ich ihn um ein vertrauliches Gespräch.Darin versuchte ich ihm seine Situation klar zu machen und gemeinsam mit ihm nach Hilfe zu suchen. Es vergingen allerdings noch viele Wochen und wir führten ungezählte Gespräche, bis er sich tatsächlich dazu bereitfand, gemeinsam mit mir einen Termin bei einer örtlichen Drogenhilfestelle wahrzunehmen. Er war reichlich „neben der Spur“ beim ersten Termin, aber er war tatsächlich bereit, die dort verabredete ambulante Hilfe anzunehmen. Leider betrug die Wartezeit zu dieser Zeit ein halbes Jahr. Zudem sollte er in dieser Zeit noch einmal seinen Willen auf Annahme des Angebotes durch ein Telefonat bekräftigen.
Jedoch verschlechterte sich der körperliche und psychische Zustand meines Bruders zunehmend, denn seine paranoiden und suizidalen Gedanken kompensierte er durch höheren Beikonsum. Zuletzt lag er beinahe ganztägig dämmernd im Bett und sprach in den wenigen wachen Momenten davon, nicht mehr weiterleben zu wollen. In dieser Situation wusste ich keinen Rat mehr und wandte mich an die zuvor kontaktierte Drogenhilfeeinrichtung. Dort erhielt ich den Rat, ihn nach Möglichkeit umgehend stationär einzuweisen, bestenfalls mit seiner Einwilligung. Wider Erwarten stimmte er meinem eindringlichen Appel auf Aufnahme in einem Krankenhaus tatsächlich zu. Zum vereinbarten Termin erwartete er mich tatsächlich mit gepackter Tasche und ich brach mit ihm auf zum Krankenhaus.
Er bat unterwegs darum, unterwegs noch einmal gemeinsam einen Kaffee zu trinken. Er wollte Zeit damit gewinnen, denn er hatte deutlich Angst. So kehrten wir in ein nettes Kaffee ein, das auf dem Weg lag, und sprachen über seine Ängste. Er war kurz davor abzusagen und wieder nachhause zu gehen. Doch gelang es mir schließlich, durch gutes Zureden ihm Mut zuzusprechen und schließlich den Weg zum Krankenhaus fortzusetzen.
Bei der Aufnahme wurde allerding klar, nach der Anamnese, die er allein bewältigte, dass für ihn nur ein Platz in der geronto-psychiatrischen Abteilung bereit stand. Er ließ sich jedoch darauf ein und bezog ein Bett zunächst in einem Einzelzimmer. Ich besuchte ihn jeden Tag, brachte frische Wäsche und leckere Abwechslung von der Krankenhausküche. Er hatte ohnehin so gut wie keinen Appetit. Dann setzte der Entzug von den Benzos ein und er – und somit auch ich – gingen durch die Hölle. Die einzelnen Stationen dieses Entzuges will ich hier nicht schildern, nur so viel: er war entsetzlich und währte weit über den Krankenhausaufenthalt hinaus. Letztlich dauerte es über zwei Jahre, bis sich seine Gehirnchemie einigermaßen wieder auf Normalmaß eingependelt hatte.
Er hatte insgesamt jedoch Glück, denn seine Psychose verschwand rascher und beinahe vollständig. Diese ganze Zeit hat mir, als zu seinem einzigem Vertrauten – unsere Eltern waren längst Verstorben -, viel abverlangt. Ich war zudem noch voll berufstätig. So begab ich mich auf die Suche nach eigener Unterstützung. Leider wurde ich bei der örtlichen Drogenberatung abgewiesen: man können für mich als Angehörigem nicht tun. Ich solle stattdessen den Betroffenen schicken, so der denn wolle. „Ach so, er wohnt in der Nachbarstadt, dann soll er die Drogenberatung dieses Ortes aufsuchen. Wir können hier nichts für Sie und ihn tun. Aber gehen Sie doch zur Selbsthilfegruppe, die sich hier neu gegründet hat“.
Sehr deprimiert von diesem Gespräch machte ich mich tatsächlich auf zu einem Treffen des Bochumer Eltern- und Angehörigenkreis. Dort erfuhr ich eine freundliche und hilfsbereite Aufnahme und konnte mich endlich einmal mit Gleichbetroffenen austauschen. Hier lernte ich schnell meine Schuldgefühle und Scham abzulegen und konnte langsam wieder in einen „Normalmodus“ zurückkehren. Als ich hier von den Seminaren und Aktivitäten der Arwed e.V. erfuhr, dem Landesverband der Elternkreise in NRW, beteiligte ich mich gern daran und konnte auf diese Weise mein Wissen über den Gebrauch und/oder Missbrauch von Drogen vertiefen und traf auf viele Menschen, die meine Sicht auf die Abhängigkeit zurecht rückten.
Dafür bin ich sehr dankbar und möchte nun etwas davon zurückgeben, indem ich meinen Angehörigenkreis aktiv unterstütze und weiterbringe, indem ich mittlerweile selbst Seminarangebote organisiere und durchführe. Mein Bruder hatte in seinem über 50-jährigem Leben schon viele Erfahrungen mit Klinikaufenthalten und dort durchgeführten Entgiftungen. Warum er nun seitdem letzten Aufenthalt ohne Beikonsum auskommt und erstmals beginnt, sein eigenes Leben zu gestalten, kann ich nur ahnen. Ich freue mich jedoch für ihn ebenso wie für mich und hoffe, dass dieser positive Verlauf andere Menschen ermutigt durchzuhalten.