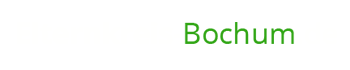Ein kleiner Einblick von Jennifer
Ich habe mittlerweile, nach fast 10 Jahren, für mich einen Weg gefunden mit der Drogenabhängigkeit meines Sohnes zurechtzukommen. Es hat für mich Jahre gedauert und es war ein Prozess. Schritt für Schritt bin ich da reingewachsen. Anfangs habe ich noch versucht meinen Sohn davon zu überzeugen mit den Drogen aufzuhören, ihn kontrolliert, zur Drogenberatung und zum Suchttherapeuten geschleppt, unzählige Gespräche mit Ihm und seinem damaligen Chef geführt, ihm ständig aus der Patsche geholfen, Geld zugesteckt, ihn in der geschlossenen Psychiatrie besucht, Wohnungen besorgt… etc.
Es ist mir immer schwerer gefallen ihn in seinen psychotischen Phasen zu erleben bzw. zu ertragen, von seinen Straftaten und schweren Körperverletzungen zu hören, wenn wir uns trafen und er mir davon erzählte. Ich erkannte ihn nicht mehr wieder. Daran bin ich fast zerbrochen, weil ich mich gegenüber meinem Sohn nicht abgrenzen konnte… Das ist unheimlich schwer, aber es war notwendig. Dadurch bin ich krank geworden und für ca. 1 ½ Jahre arbeitsunfähig gewesen. Schuldgefühle plagten mich, als Mutter versagt zu haben… Zum Schluss ging gar nichts mehr und ich bin in eine psychosomatische Klinik eingewiesen worden. Dort habe ich angefangen, mich um mich und meine Bedürfnisse zu kümmern. Das war nicht leicht, denn eigentlich wollte ich nur Hilfe, wie ich meinen Sohn dazu bekäme mit den Drogen aufzuhören.
Eine Therapeutin in der Klinik sagte damals zu mir, wenn mein Sohn mich aus einer Langzeittherapie anrufe und um Hilfe bäte, dann könne ich anfangen ihm zu helfen, bevor das nicht passiere, könne ich nur zu Gott beten. Er müsse den Willen haben und die Entscheidung selbst treffen. Da wurde mir bewusst (und ich muss mich jedes Mal daran erinnern, wenn ich schwach werde), dass ich es nicht in der Hand habe und ich nichts machen kann, außer zu beten, damit mein Sohn damit aufhört. Akzeptieren und Loslassen.
Nach dem Klinikaufenthalt habe ich eine Gruppentherapie gemacht. Als ich merkte, dass ich Gleichgesinnte brauchte, suchte ich mir diese Selbsthilfegruppe und stieß auf Ulrike, die mich aufmunterte zu kommen, da die Gruppe sonst nicht bestehen könnte. Mittlerweile sind wir gewachsen. Hier in der Selbsthilfegruppe fühle ich mich verstanden mit meinen ambivalenten Gefühlen. Jeder von uns steht an einem anderen Punkt, aber wir geben uns gegenseitig Halt in unseren schwachen Momenten. Manchmal ist es aber auch zu viel von der Thematik und ich brauche eine Pause. Auch das ist ok.
In der Therapie habe ich mich meiner größten Angst gestellt – dass mein Sohn an einer Überdosis sterben kann. An schlechten Tagen zieht mich das immer noch runter. Ich habe gelernt das Verhalten meines Sohnes zu akzeptieren, aber es tat mir weh, dabei zuzusehen, wie er sich zugrunde richtete. Ich fing an mich abzugrenzen. Bei einem Treffen erzählte er mir wieder von irgendwelchen Schlägereien mit der Polizei unter Drogen und Alkoholeinfluss und dass er wieder mal in der Ausnüchterungszelle schlafen musste. Daraufhin sagte ich ihm, dass ich das alles nicht mehr hören könne. Ich müsse es leider akzeptieren, dass er Drogen nehme, aber ich möchte nicht zusehen, wie er sich dabei zugrunde richte. Das täte mir als Mutter weh. Ich möchte ihn in meiner Wohnung nicht mehr zugedröhnt sehen. Wenn er ernsthaft Hilfe bräuchte, um von den Drogen wegzukommen, wäre ich für ihn da. Daraufhin kam er monatelang nicht mehr vorbei.
Das war zwar hart, aber auf Dauer geht es mir damit besser. Seit 4 Jahren kann ich wieder arbeiten, bin wieder in meiner Kraft und habe auch glückliche Momente und darauf habe auch ich ein Recht.
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden.
Mein Sohn hat mit 15 Jahren das Kiffen angefangen, viel hochprozentigen Alkohol getrunken, mit ca. 18 Jahren gemeinsam mit seinem Vater härtere Drogen, wie Speed, Pepp und Pillen konsumiert. Darauf hängen geblieben und Psychosen entwickelt. Er ist jetzt 25 Jahre alt.
Was er momentan konsumiert, weiß ich nicht, weil er es mir nicht sagen wollte. Das ist auch gut so. Er lebt mittlerweile auf der Straße, hat einen Betreuer, der seine Finanzen regelt, er saß sieben Monate wegen gefährlicher Köperverletzung im Gefängnis und wir sehen uns vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Im Winter, wenn es richtig kalt wird und wir minus Temperaturen haben, mache ich mir schon Sorgen, ob er die Nacht überlebt, aber ich kann es nicht ändern. Er will so leben. Auf der Straße mit Drogen und Alkohol.